
Karl Stary um 1939 (aus
Privatbesitz)
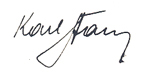
Karl Stary war ein
Mensch, der um jeden Preis eine Buchhandlung besitzen
wollte, wie wir aus nachfolgenden Begebenheiten sehen
können. Alle Handlungen, die er setzte, brachten
aber letzten Endes nicht das von ihm erstrebte Ergebnis.
Lösungsversuch:
Verringerung der Anzahl der Buchhandlungen
Nach dem Anschluss
Österreichs an das Deutsche Reich (12./13. März
1938) wandte sich Karl Berger am 5. Mai 1938 als kommissarischer
Leiter der „Österr. Buch-, Kunst- und Musikalienhändler“
an den Gauleiter Bürckel, um auf die prekäre
Lage des österreichischen Buchhandels aufmerksam
zu machen. In einer leicht veränderten Fassung wurde
dieser Brief als Denkschrift mit der Datierung vom 9.
Juni 1938 vervielfältigt und verteilt. Laut dieser
„Denkschrift“ gab es in Wien zum damaligen Zeit achthundert
Buchhandlungen, bei einer Bevölkerungszahl von 1,8
Millionen also eine auf 2250 Einwohner. Zum Vergleich:
In Graz (153.000 / 33) und Linz (102.000 / 18) betrugen
die Verhältniszahlen mehr als das doppelte (rund
4600 in Graz bzw. 5600 in Linz). „Die Existenzmöglichkeiten
in beiden Städten sind also für den Buchhändler
doppelt so groß als in Wien“. Als weitere Beispiele
führt Berger die Städte Groß-Hamburg (7800
Einwohner auf eine Buchhandlung), Bremen (7500), Essen
(9600), Bochum (14000) und Dortmund (15000) an.
Neben einer Reihe anderer Verbesserungsvorschläge
führte Berger ins Treffen, dass eine „Reduzierung
der Betriebe“ zur „Gesundung des Buch-, Kunst- und Musikalienhandels“
unbedingt notwendig sei. Berger wollte aber nicht „bestehende
Werte [...] zerstören, sondern planmäßig
die jüdischen Betriebe [...] liquidieren, bzw. dort,
wo dies nicht möglich ist, diese zu arisieren.“
Diejenigen Sortimenter, die an den Anschluss große
Hoffnungen gesetzt und diesen mit Euphorie begrüßt
hatten, wurden in der Anfangsphase der nationalsozialistischen
Herrschaft in Österreich schwer enttäuscht.
Durch die Währungsreform konnten die zum Kurs von
1 Reichsmark = 2 Schilling eingekauften Bücher nur
mehr zum Kurs von 1 RM = 1,50 Schilling verkauft werden.
Da die Standesführung vom Börsenverein bei der
Währungsreform kein Entgegenkommen erwirken konnte,
waren viele Sortimenter von ihr enttäuscht und so
kam es, dass sich 17 Betriebe zu einer „Arbeitsgemeinschaft
der Wiener N.S. Buchhändler“ (in der Folge: „Wr.
N.S. Buchhändler“) zusammenschlossen. In einem entsprechenden
Zeitungsinserat zeichneten folgende (sechzehn) Firmen:
Die Becksche Universitätsbuchhandlung, Karl Berger,
Josef Deubler, die Eckart-Buchhandlung, Karl Hanke, Robert
Kleemann, Hans Knoll, Rudolf Krey, Josef Letz, Rudolf
Lucek, Franz Matzner, Wilhelm Maudrich, Karl Mück,
Rudolf Mück jun., A. Pichler Wwe. und Sohn sowie
Walter Saulich.
Die „Wr. N.S. Buchhändler“ verlangten in einem (undatierten)
Brief an Karl Berger in noch schärferen Tönen
eine „sehr einschneidende Verringerung der Buchhandlungen“,
da „Konzessionsverleihungen“ an „nicht bodenständige
Konzess.-Werker [...] weit über den Bedarf hinausgegangen“
seien. Die hochgespannten Erwartungen der „Wr. N.S. Buchhändler“,
die offenbar auf eine Liquidierung aller Buchhandlungen
jüdischer Besitzer abzielten, wurden nicht erfüllt.
In einem vom 11. Juni 1938 datierten Brief klagten sie,
dass zu viele der „jüdischen Betriebe“ arisiert anstatt
liquidiert wurden.
Die Standesvertretung
der Buchhändler, der „Verein der Buch-, Kunst- und
Musikalienhändler“, ab 1. 1. 1937 in „Zwangsgilde
der Buch-, Kunst- und Musikalienhändler“ umbenannt,
konnte nach dem Anschluss nur mehr drei Monate fortbestehen.
Am 15. Juni 1938 trat das Reichskulturkammer-Gesetz in
Kraft. Damit verlor Karl Berger als (selbsternannter kommissarischer)
Leiter der Zwangsgilde seine führende Position; das
Sagen hatte nunmehr – in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer
der Abteilung Buchhandel der Reichsschrifttumskammer (RSK),
Abteilung Österreich – Dr. Karl Zartmann. Der Verein
der Buch-, Kunst- und Musikalienhändler wurde am
9. August 1938 zusätzlich behördlich aufgelöst.
Diese Abteilung Buchhandel war (wie auch die Korporation
bzw. Zwangsgilde) in Wien I., Grünangergasse 4 beheimatet.
Meldepflicht
für Inhaber von Buchhandlungen
Laut dem „Gesetzblatt
für das Land Österreich“, 191/1938, 66. Stück,
hatten sich alle Inhaber von Buchhandlungen und auch deren
Angestellte bis zum 30. Juni (!), also innerhalb nur weniger
Tage, bei der zuständigen Einzelkammer in Berlin
zu melden. Diese Fristsetzung war völlig irreal und
konnte vielfach nicht eingehalten werden.
In dem vom 25. Juni 1938 datierten Rundschreiben Nr. 5
der Kommissarischen Leitung der Zwangsgilde der Wiener
Buch-, Kunst- und Musikalienhändler liest man:
„Der Anmeldung ist die Versicherung beizufügen,
ob der Antragsteller deutschen oder artsverwandten Blutes
ist; bis spätestens zum 30. September 1938 ist an
die gleiche Stelle der urkundliche Nachweis der Abstammung
zu liefern. Erst nach vollzogener und geprüfter Nachweisung
kann über die entgültige [sic!] Aufnahme entschieden
werden; bis zu dieser Entscheidung ist der Angemeldete
in der Ausübung seiner Tätigkeit nicht behindert,
es sei denn, dass sie ihm ausdrücklich untersagt
wird.“
Damit verloren die früheren Buchhandelskonzessionen
ihre Gültigkeit, für die Berufsausübung
war nur mehr die Mitgliedschaft in der jeweiligen Fachabteilung
der RSK ausschlaggebend.
Der neue Besitzer
der Wallishausserschen Buchhandlung ist lt. Handelsregisterauszug
ab 27. Jänner 1939 Karl Stary. Bereits am 1. Oktober
1938 stellt er ein Ansuchen um
Genehmigung zum Erwerb der Wallishausserschen Buchhandlung,
obwohl Max Bardega und Franz Bader zu diesem Zeitpunkt
noch offizielle Besitzer der Firma sind. Vom 27.
September 1938 findet sich von Max Bardega ein gegenteiliges
Ansuchen um Genehmigung der Veräußerung (mit
einem verlangten Preis von RM 8.500,00), aus dem zu entnehmen
ist, dass in der Wallishausserschen Buchhandlung 2 Praktikanten
(einer davon Franz Bronhagl) und ein Stundenbuchhalter
beschäftigt sind. Von diesem Zeitpunkt an müssen
wir auch über die Buchhandlung „Altes Rathaus“ berichten,
da die beiden Buchhandlungen ab nun miteinander verwoben
sind. Karl Stary stellte schon am 24. Juni 1938, erst
drei Monate nach der Besetzung Österreichs durch
deutsches Militär, einen Antrag um Erwerb der Buchhandlung
„Altes Rathaus". Wieder drei Monate später stellt
er den zweiten Antrag für den Erwerb der Wallishausserschen
Buchhandlung. Das lässt den Schluss zu, dass es eine
länger vorbereitete und wohl überlegte Aktion
gewesen ist. Die Buchhandlungen liegen relativ nahe beieinander,
am Lichtensteg und in der Wipplingerstraße.
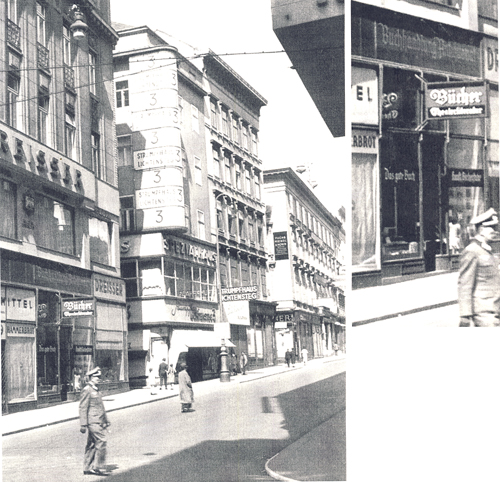
Lichtensteg
während des Krieges
Den Werdegang Karl
Starys bis zum Jahre 1938 ersehen wir aus seinem Lebenslauf.
Ab März 1938 war er Geschäftsführer der
Buchhandlung „Altes Rathaus“ in der Wipplingerstraße.
Der Besitzer, Dr. Gutwillig Gustav, befindet sich krankheitshalber
in Italien. Nun tritt Karl Stary als Kaufwerber auf, es
ergeben sich jedoch Probleme. Nach einem ihr zugekommenen
Bericht lehnt die Reichsschrifttumskammer, Landesleitung
Österreich, die Übernahme der Buchhandlung „Altes
Rathaus“ durch Karl Stary ab, mit der Begründung,
dass er einen ca. ein Jahr zurückliegenden Offenbarungseid
in Bezug auf die Firma Maudrich leisten musste.
Obwohl sich die NSDAP ausdrücklich für die Erhaltung
und damit für die „Arisierung“ der Buchhandlung „Altes
Rathaus“ aussprach, folgte diese Auffassung nicht unbedingt
der mehrmals genannten Absicht der RSK. Stary hatte auch
ständig mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Die RSK lehnte Stary als nicht kompetente Persönlichkeit
ab. Die Gründe für die negative Beurteilung
Karl Starys gestalteten sich vielschichtig und fußten
u. a. auf zwei Vorwürfen: einerseits warf man ihm
vor, als Vertreter der Berliner Firma „Büchermarkt“
an Kunden in der „Ostmark“ direkt Aufträge ausgeführt
zu haben. Dies war aber aufgrund einer Bestimmung des
Reichswirtschaftsministeriums vom 13. März 1938 untersagt
gewesen, um die dort ansässigen Unternehmungen zu
schützen. Karl Stary hatte mit Hilfe der Konzession
Leopold Kutscheras im Jahre 1936 selbstständige Buchgeschäfte
getätigt, zu denen er laut Vertrag mit der Firma
„Büchermarkt“ nicht berechtigt gewesen war. Andererseits
hatte er von der Firma Maudrich medizinische Bücher
bezogen, die er an seine Kunden weiterverkaufte, ohne
sie der Firma Maudrich bezahlt zu haben. Diese hatte sich
gezwungen gesehen, Karl Stary zu klagen, und er hatte
am 18. Februar 1937 einen Offenbarungseid geleistet. Der
Großteil der Schulden war auch noch zum Zeitpunkt
der negativen Beurteilung Starys seitens der RSK offen.
Kein noch so begründeter Einwand seitens der RSK
konnte die zuständige Parteistelle davon abhalten,
Karl Stary positiv zu beurteilen. Die Bevorzugung half
jedoch nicht, seine Karriere als kommissarischer Leiter
der Buchhandlung „Altes Rathaus“ hielt nicht lange an.
Stary zählte wohl zu den ersten Opfern, die im Zuge
des Kampfes des „Reichskommissars für die Wiedervereinigung
Österreichs mit dem Deutschen Reich“, Josef Bürckel,
gegen das Kommissar(un)wesen entmachtet wurden.
Die „Prüfstelle für kommissarische Verwalter“
in der Vermögensverkehrsstelle (VVSt) wandte sich
am 19. Juli 1938 an den kommissarischen Leiter des österreichischen
Buchhandels, Karl Berger. Der „Staatskommissar in der
Privatwirtschaft“, DI Walter Rafelsberger, forderte Berger
auf, ihm „einen geeigneten Mann, Parteigenossen und fachlich
qualifiziert, bekannt zu geben, der an Stelle des von
Ihnen als „untauglich“ bezeichneten komm. Verwalters Karl
Stary in der Buchhandlung „Altes Rathaus“, Wien I., Wipplingerstr.
8, einzusetzen wäre.“. Die Begründungen sind
immer dieselben. Ab 22. Juli fungierte Gottfried Linsmayer
als neuer kommissarischer Verwalter der Buchhandlung „Altes
Rathaus“.
Durch nichts war Karl Stary von seinem Vorhaben abzubringen
und so schloss er am 29. September 1938 einen weiteren
Kaufvertrag bezüglich der Übernahme der Firma
„Altes Rathaus“ ab, in dem nun der kommissarische Verwalter
Gottfried Linsmayer stellvertretend als Verkäufer
auftrat.
In einem Schreiben
an die Vermögensverkehrsstelle im Ministerium für
Wirtschaft und Arbeit z. H. des Herrn Referenten v. Meisel
heißt es:
Gesuch um Genehmigung des Ankaufs einer Buchhandlung
(Altes Rathaus). Seite 3:
........ Ich verpflichte mich hiemit ausdrücklich,
die von mir ebenfalls käuflich erworbene Wallishauser’sche
Buchhandlung A.W. Künast stillzulegen und die Geschäftsräume
dieser Buchhandlung nicht zu benützen, sondern die
gesamten von mir erworbenen Warenvorräte in die Buchhandlung
„Altes Rathaus“ einzubringen, unter der Voraussetzung,
dass mir
1,) sowohl die Erwerbung der Wallishauser’schen Buchhandlung,
als auch
2.) die Erwerbung der Buchhandlung „Altes Rathaus“ genehmigt
wird.
In Übereinstimmung mit den mir gegenüber geäußerten
Wünschen des Vertreters der Reichsschrifttumskammer
bin ich bereit, im Interesse gesünderer Wettbewerbsverhältnisse
im I. Bezirk in Wien die Wallishauser’sche Buchhandlung
aufzulassen und nur die Warenvorräte in die Buchhandlung
„Altes Rathaus“ zu übersiedeln. Die von mir hiemit
abgegebene Verpflichtung zur Stilllegung der Wallishauser
Buchhandlung und zur Auflassung deren Betriebsstätten
ist für mich absolut rechtsverbindlich, soferne mir
die Erwerbung von den hiezu befugten Stellen genehmigt
wird. Mit Rücksicht auf das Vorgebrachte
stelle ich den Antrag auf Genehmigung
des Ankaufes des Lagerstandes der Buchhandlung Wallishauser
A. W. Künast,
der Buchhandlung „Altes Rathaus“ Wien, I., Wipplingerstrasse
8, (Stoss im Himmel).
Karl Stary. Wien, am 29. Sept. 1938.
Im selben Gesuch äußerte sich Stary über
seine pekuniäre Situation:
„In finanzieller Hinsicht stehen mir ausreichende
Mittel zur Verfügung, um den Betrieb der Buchhandlung
„Altes Rathaus“ in der bisherigen Weise aufrecht erhalten
zu können, und zwar habe ich RM 20.000,- bereits
im gegenwärtigen Zeitpunkt und werde von einem Verwandten
zu günstigen Bedingungen am 1. I. 1939 einen weiteren
Betrag von RM 20.000,- zum Betrieb der Buchhandlung zur
Verfügung gestellt erhalten.“ [Österr.
Staatsarchiv, Allgem. Verwaltungsarchiv, Innenminist.,
Arisierungsakt Wallishausser-Buchhandlung u. Altes Rathaus,
Dr. Gutwillig]
Dies wäre der Todesstoss für die Wallishaussersche
Verlagsbuchhandlung gewesen, hätte sich Stary den
Vorschriften nach an die Vereinbarung gehalten.

Wieder greift
ihm die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei,
Gauleitung Wien, unter die Arme und stellt ihm das beste
Zeugnis aus: „Pg. Stary hat
sich für die nationale Idee bereits im Jahre 1920
betätigt."
Da er wohl die Geschäfte
interimistisch weitergeführt haben dürfte, sollte
seine Abwesenheit nur von kurzer Dauer sein.
Er begann die Vorbereitungen für die Übernahme
der Buchhandlung „Altes Rathaus“ bereits während
seiner Tätigkeit als deren Geschäftsführer.
Ein am 23. Juni 1938 aufgenommenes Gedächtnisprotokoll
zwischen Karl Stary und Dr. Alois Hey als bevollmächtigter
Vertreter Dr. Gustav Gutwilligs – dieser hielt sich
bereits seit Februar 1938 in Italien auf – legte
die Bedingungen für die Geschäftsüberleitung
fest.
Die „Arisierungsverfahren“ der beiden Betriebe wurden
von Karl Stary beinahe parallel vorangetrieben. So ließ
er ebenfalls im September den Kaufpreis für die „Wallishausser’sche
Buchhandlung“ in einem Gedächtnisprotokoll festsetzen.
Als seine Vertragspartner fungierten der öffentliche
Gesellschafter der Buchhandlung Franz Bader und stellvertretend
für den Mitbesitzer Franz Bardega der Rechtsanwalt
Dr. Paul Kaltenegger. Die Ablösesumme von 8.500,-
RM ergab sich folgendermaßen: „Die derzeitigen Warenvorräte
(bewertet mit RM 8.000,-) und das Inventar, (bewertet
mit RM 500,-) sowie die der Firma gehörigen, nicht
eigens bewerteten [sic!] Verlagsrechte.“
Für die
RSK ist Stary „abzulehnen“, da „vermögenslos und
verschuldet“
Die RSK war kein Freund Starys, sie präferierte Josef
Letz (einen ebenfalls für die NSDAP verdienten Parteigenossen
und „Wr. N.S.-Buchhändler“), wie in einem Schreiben
vom 12. September 1938 festgehalten ist.
Die NSDAP
setzt sich durch: Karl Stary erhält die Wallishaussersche
Buchhandlung
Entgegen den Intentionen der RSK, die sich von Stary nicht
allzu viel versprach und mehr auf die Fähigkeiten
des von ihr vorgeschlagenen Josef Letz vertraute, setzte
sich letztlich die NSDAP durch. Es war eine gängige
Methode, dass sie einem „alten Kämpfer“ seine frühe
Parteimitgliedschaft nicht vergaß. Immerhin hatte
Stary im Jahre 1927 dem Führer in München über
die beiden österreichischen nationalsozialistischen
Parteiunternehmungen Bericht erstattet. Die NSDAP entschädigte
den verdienten Parteigenossen Stary für die Benachteiligung,
die er im Ständestaat erfahren hatte, mit der Arisierung
der Wallishausserschen Buchhandlung.
Dr. Zartmann
befürwortet Starys Übernahme der Wallishausserschen
Buchhandlung
3. [...] Die
Reichsschrifttumskammer ist auf dem Standpunkt gestanden,
dass die Zahl der Buchhandlungen in Wien unter allen Umständen
verringert werden müsse und daher Arisierungsanträge
nur unter besonders zu berücksichtigenden Umständen
gegeben werden; so hatte die Reichsschrifttumskammer beschlossen,
dass der Buchhandlung [Altes Rathaus] die Bewilligung
ein Sortimentsgeschäft zu führen, entzogen werde
und an die Stelle dieses das Sortimentsgeschäft Wallishauser
[sic] verlegt werde. Nun hat sich die Lage folgendermassen
geändert:
Daß der Inhaber der Wallishauser’schen Buchhandlung
ohne irgend ein Entgelt zu bezahlen, die laufende Kundschaft
des Alten Rathauses an sich gezogen hätte und ausserdem
eine Reihe von Reisebuchhandlungs-Kundschaft erworben
hätte, wobei noch die Gefahr gewesen wäre, dass
die Wallishauser’sche Buchhandlung, deren Handlungsbewilligung
uneingeschränkt ist, einen Reisevertrieb hätte
beginnen können, wodurch der Käufer der Buchhandlung
Altes Rathaus schwer geschädigt worden wäre.
Insbesondere wäre die Schädigung zu Tage getreten,
wenn der neue Eigentümer der Buchhandlung Altes Rathaus
seinen Sitz verlegt hätte und die Wallishauser’sche
Buchhandlung sich die Lokalbezeichnung „Altes Rathaus“
beigelegt; denn diese Bezeichnung ist weder handelsgerichtlich
protokolliert noch in irgend einer anderen Form geschützt.
Es waren zwei Kaufwerber vorhanden u. zw. Herr Karl Stary
und Herr Josef Letz.
Der Antrag des Herrn Karl Stary war bereits einmal abgelehnt
worden, wodurch Herr Karl Stary, wie in meinem ersten
Bericht bereits angedeutet, aus einer drückenden
Vertragsverbindlichkeit befreit wurde. Herr Stary zog
aus der ihm bekannt gewordenen Entscheidung der Reichsschrifttumskammer
den Entschluss, die Wallishauser’sche Buchhandlung sofort
zu erwerben. Er konnte dies ohne weiteres, weil der Inhaber
der Buchhandlung ein Ausländer war und daher der
Übergang dieser Firma ohne weitere Genehmigung erfolgen
konnte.
Genehmigung
durch die RSK und die VVSt
Die RSK gab schließlich ihre Bedenken auf und damit
genehmigte die Vermögensverkehrsstelle (VVSt) die
Ankäufe der Buchhandlung „Altes Rathaus“ und „Wallishausser’sche
Buchhandlung“ durch Karl Stary. Er musste lediglich einige
weiter unten erwähnte Auflagen erfüllen.
Auflagen
für Stary
Karl Stary musste die Geschäftsräume der Wallishausser’schen
Buchhandlung aufgeben und nur die erworbenen Warenvorräte
in die Buchhandlung „Altes Rathaus“ übersiedeln.
Die Vorgangsweise entsprach wiederum den Absichten der
RSK, durch die Verminderung der Buchhandlungen in der
Inneren Stadt „gesündere“ Wettbewerbsverhältnisse
zu erzielen.
In einer Beilage 1 zur Bewilligung vom 24. November 1938
findet sich noch folgender Passus, der das Schicksal der
Wallishausserschen Buchhandlung amtlich besiegelt:
„Es wird Ihnen zur Auflage gemacht, mit den
übernommenen Waren und Einrichtungsgegenständen
in die Buchhandlung „Altes Rathaus“ Wien I., Wipplingerstr.
8 zu übersiedeln und die Wallishausersche Buchhandlung
A. W. Wienast [!], Wien I., Lichtensteg 1, aufzulassen.“
Hinsichtlich seiner
finanziellen Situation musste Karl Stary den Nachweis
erbringen, dass er seinen Verbindlichkeiten gegen die
Firma Maudrich nachkäme und über genügend
Betriebskapital verfüge.
Karl Stary führte
nun sein Unternehmen unter der Bezeichnung „Wallishausser’sche
Buchhandlung“ in der Wipplingerstraße 8. Aus seinem
am 30. Dezember 1938 ausgefüllten Einzelfragebogen
zur Aufnahme in die RSK werden einige Daten über
die Buchhandlung „Altes Rathaus“ ersichtlich. Sie umfasste
die Bereiche Sortiment, Reisebuchhandel, Leihbücherei.
Der Betrieb beschäftigte zehn Personen, drei im Sortiment
und sieben in der Reisebuchhandlung, von denen laut Starys
Angaben nur drei zum damaligen Zeitpunkt in der RSK, Gruppe
Buchhandel, angemeldet waren. Ähnlich verhielt es
sich mit den fünf Vertretern, deren Aufnahmeverfahren
sich erst in Bearbeitung befanden. In Bezug auf diesen
Umstand sollte Karl Stary mit der RSK in späterer
Folge noch Schwierigkeiten bekommen.
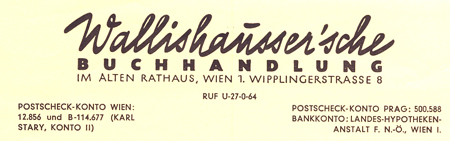
Stary wird
(mit Ralph Högers Hilfe) Verleger
Den Anstoß für die Probleme Karl Starys mit
der RSK lieferte sein Ansuchen um Aufnahme in die Fachschaft
„Verlag“ vom 7. Jänner 1943. Denn ab diesem Zeitpunkt
beabsichtigte er offiziell, die Verlagstätigkeit
wieder aufzunehmen. Darauf reagierend beauftragte die
RSK Wilhelm Chlumecky, eine Bücherrevision in Karl
Starys Firma vorzunehmen und über das Ergebnis Bericht
zu erstatten. Der Buchsachverständige kam zu dem
Schluss, dass keine geordnete Buchführung vorläge
und die Verlagsgeschäfte sehr undurchsichtig seien.
Hinter der zweiten Beanstandung steckte der Vorwurf, dass
Karl Stary schon seit längerer Zeit seiner Sortimentsbuchhandlung
eine Verlagsabteilung angegliedert hätte, ohne dafür
die Berechtigung zu besitzen, da er kein Mitglied der
Fachschaft „Verlag“ innerhalb der RSK war. Ein weiterer
Grund für die mehrmals verhängte Ordnungsstrafe
von 10.000,-- RM war die Beschuldigung, dass Stary in
der Wallishausser’schen Buchhandlung Personen, die nicht
der RSK angehörten, beschäftigte. Beide Beanstandungspunkte
finden sich in einem Brief der RSK, Landesleitung Österreich,
an die RSK in Leipzig:
„Vielfache Gerüchte im Wiener Buchhandel wollten
davon wissen, dass die verlegerische Tätigkeit nicht
von Herrn Stary ausgeübt wird, sondern von einem
gewissen Herrn Ralph A. Höger, Wien I., Biberstraße
22. Höger stellte seinerzeit einen Antrag um Aufnahme
in die Reichsschrifttumskammer, wurde aber wegen jüdischer
Versippung seiner Frau und ausserdem wegen seiner übermässigen
Privat- und Geschäftsschulden, die er in leichtfertiger
Weise anlegte, abgewiesen. Wir haben diese Gerüchte
von der GESTAPO überprüfen lassen und es wurde
nunmehr, wie Sie aus beiliegender Abschrift ersehen, von
der GESTAPO festgestellt, daß Ralph A. Höger
seit 1940 als Buchhandelsangestellter in der Wallishauser’schen
Buchhandlung tätig war und im Jahre 1941 mit Stary
eine Verlagsproduktion bewerkstelligte. Dieser neuerliche
Vorfall bestimmt uns nun den Antrag zu stellen, Herrn
Stary nochmals mit einer exemplarischen Ordnungsstrafe
deswegen zu bestrafen, weil er bewusst nicht Kammermitglieder
in seinem Betrieb beschäftigt hatte und selbst nur
als Strohmann gelten kann für eine Verlagsproduktion,
für die er persönlich keinerlei Fähigkeiten
besitzt.“
Ganz so unberechtigt war also die frühere Ablehnung
Starys durch die RSK nicht gewesen, denn auch nach der
Protegierung durch die NSDAP und der dadurch ermöglichten
Übernahme der Wallishausserschen Buchhandlung agierte
Karl Stary als Unternehmer, der es mit dem Gesetz nicht
so genau nahm. Darüber hinaus bezahlte Stary die
„Arisierungsauflagen“ nur zum kleinen Teil, auch diesbezüglich
erwies er sich als unverlässlicher Bündnisgenosse.
Man kann mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass jede
Initiative zu Verlagstätigkeiten zuerst von Ralph
A. Höger ausging.
Ralph Höger hat die
Tradition der Wallishausserschen Buchhandlung aufgegriffen,
wie aus nachfolgender Verlagsreklame ersichtlich.
Später war das
Verhältnis zwischen Stary und Höger getrübt,
wie aus einem Schreiben Ralph Högers vom 7.3.1943
an Franz Bronhagl ersichtlich.
Starys Verlag
firmierte in Wien und Leipzig
Bei der Leipziger Adresse Hospitalstraße (heute:
Pragerstraße) Nr. 10 handelt es nur um eine Auslieferungsadresse,
und zwar der des „Volckmar-Hauses“.
Bei den Verlagsreklamen führte
Stary immer die Adresse Wien und Leipzig an, wie aus der
Beilage ersichtlich. Stary ergriff jede Möglichkeit,
um für die Wallishaussersche Buchhandlung zu werben,
von einer Buchhandlung "Altes Rathaus" ist keine
Rede mehr. Sie scheint stillschweigend verschwunden zu
sein. Noch ein Beispiel für die Werbetätigkeit
Starys sind Buchhandlungskataloge der Jahre 1940 und 1941/42.
Kataloge dieser Art wurden verlagsseitig mit dem Aufdruck
der belieferten Buchhandlung auf dem vorderen Umschlag
ausgeliefert, der Kunde gewann den Eindruck, dass der
Katalog eigens für den Sortimenter gedruckt worden
war.
Der links abgebildete Katalog stammt aus dem Leipziger
Verlag Eduard Avenarius und umfasst 140 und 16 Seiten,
sowie 8 Tafeln. Der rechte, 76seitige Katalog wurde 1941
oder 1942 vom Verlag Koehler & Volckmar, ebenfalls
Leipzig, ausgegeben.
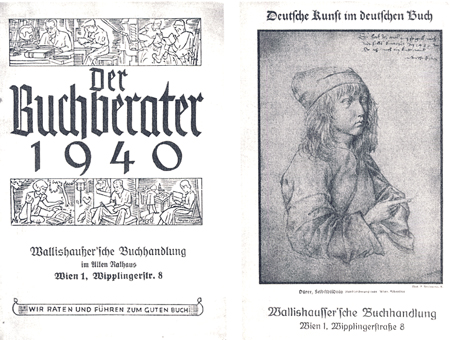
Beginn nach
dem Krieg
So negativ Starys Rolle anlässlich
der Arisierung auch zu beurteilen ist, und so wenig genau
er es mit dem Gesetz in manchen Fällen während
seiner ganzen Laufbahn auch genommen haben mag, verdient
doch festgehalten zu werden, dass es letzten Endes ihm
zu verdanken ist, dass er der weiter vorne zitierten Auflage
der Vermögensverkehrsstelle (VVSt), die Wallishaussersche
Buchhandlung „aufzulassen“ und in der (wirtschaftlich
lukrativeren) Buchhandlung „Altes Rathaus“ aufgehen zu
lassen, nicht Folge leistete. So war doch eine Verlagstätigkeit
während des Krieges festzustellen und es gab einige
Kunstbände, wie
aus dem Werkverzeichnis ersichtlich. Nach dem Krieg zauberte
er gewissermaßen die Wallishaussersche Buchhandlung
wieder aus dem Hut und versuchte die Verlagstätigkeit
fortzusetzen. Es blieb bei einem einzigen Buch: „Der Himmel
voller Geigen. Ein österreichisches Drama“ von Rudolf
Holzer. Das Werk muss vor dem 14. September 1946 erschienen
sein, „vollendet in den Jahren Österreichs tiefster
Erniedrigung“, wie es verso des Titelblattes heißt.
Schon im September 1945 suchte der inzwischen 50 Jahre
alt gewordene Karl Stary namens seiner Wallishausserschen
Buchhandlung laut einer Anzeige im „Antiquariat“, 1. Jg
(1945), Nr. 2, S. 5, alle Jahrgänge des Aglaja-Taschenbuches
für das „Verlagsarchiv“, was immer Stary auch darunter
verstanden haben mag.
Seine politische Bredouille versuchte
er auf eine etwas diffuse Art zu lösen, indem er
den Sachverhalt im Jahr 1945
seiner provisorischen Standesvertretung so darstellte,
dass er der RSK eine illegale NSDAP-Mitgliedschaft vorgelogen
hatte, um weiterhin in seinem Beruf tätig sein zu
können. Doch blieb der angebliche „Mitläufer“
Karl Stary die Erklärung schuldig, wie sich seine
„wahre“ politische Einstellung zwischen 1926 und 1933
gestaltet hatte. Sein am 4. Mai 1926 vollzogener Beitritt
zur Hitlerbewegung war wohl ebenso wie das beweiskräftige
Schriftstück spurlos verschwunden. Die Zwangsgilde
hatte allerdings, selbst wenn sie einem Buchhändler
seine nationalsozialistische Vergangenheit nachweisen
konnte, keine gesetzliche Befugnis, den Betreffenden an
seiner Berufsausübung zu hindern oder diese gar zu
verbieten.
Öffentliche
Verwaltung
Da beide Buchhandlungen arisiert
wurden, wurde ein öffentlicher Verwalter vom Staatsamt
für Volksaufklärung bestellt [WStLA
MA 119/ Karton A23/70]. Unter umgekehrten Vorzeichen
griff man im Jahre 1945 wiederum auf die Methode der öffentlichen
Verwalter zurück. Davon betroffen waren Buchhandlungen,
deren Besitzer als engagierte Parteifunktionäre im
Dritten Reich bekannt waren oder deren Eigentümer
einen jüdischen Betrieb „arisiert“ hatten. Für
die Wallishausser’sche Buchhandlung wurde am 28. Juni
1945 der Chefredakteur Franz Xaver Friedrich vom Staatsamt
für Volksaufklärung zum öffentlichen Verwalter
für den gesamten Betrieb bestellt, ab 14.7.1945 auf
den Verlag eingeschränkt und am 8. 11.1945 um die
Buchhandlung erweitert. Franz X. Friedrich hat sich im
Handelsregister Zahl A7528 als öffentlicher Verwalter
eintragen lassen. Dieser Eintrag besagt, dass Herr Friedrich
alleinige Vertretungsbefugnis hat.
Die Zwangsgilde äußerte über die Wahl
seiner Person im August 1945 ihren Unmut:
„Da laut persönlicher Rücksprache mit Herrn
Karl Stary das Sortiment mit der Reise- und Versandabteilung
und nicht der Verlag die Hauptsparten des Geschäftes
darstellen (auch umsatzmäßig), so wäre
unseres Erachtens ein Buchhändler unbedingt als öffentlicher
Verwalter zu nominieren. Wir wurden ja leider wie in allen
anderen Fällen übergangen und auch nicht gebeten,
Vorschläge zu erstatten.“
Vom Staatsamt für Industrie, Gewerbe und Verkehr
wurde am 6. September 1945 als öffentlicher Verwalter
und Aufsichtsperson für die Wallishaussersche Buchhandlung
der fachlich qualifizierte Joseph Hauptvogel (er kam von
der Firma Gerold & Co.) bestellt. Es gibt nun also
für die Buchhandlung und den Verlag zwei öffentliche
Verwalter. Die Differenzen sind vorprogrammiert.
Durch den Eintrag im Handelsregister hat F. X. Friedrich
die alleinige Verfügungsgewalt. Herr Hauptvogel,
der den Auftrag hatte, sich ebenfalls ins Handelregister
eintragen zu lassen, wurde abgelehnt, da ja schon Herr
Friedrich die alleinige Verfügungsgewalt hatte. Herr
Hauptvogel trat sehr verärgert am 31. Dezember 1945
von seiner Berufung als öffentlicher Verwalter der
Wallishausserschen Buchhandlung zurück. Vom 5. Jänner
1949 gibt es einen Prüfungsbericht mit einem handschriftlichen
Nachsatz, der wortgetreu lautet: "Ö .V.
wurde bereits vorgeladen. Das K.B. wäre für
gänzliche Aufhebung der ö .V., da die Schuldenlast
so gross ist, dass mit Konkurs zu rechnen ist. R.A. nach
Rücksprache mit ö.V. verständigt."
Diesen Nachsatz scheint niemand gelesen zu haben. Unerklärlich,
warum nicht eine Änderung der Lage herbeigeführt
wurde und dieser marode Betrieb noch mit einer öffentlicher
Verwaltung belastet war und ein Anstieg der Schulden absehbar
war. Franz Xaver Friedrich wurde am 21. März 1949
der öffentlichen Verwaltung enthoben und es trat
Benedikt Gschnait an seine Stelle. Dieser wurde am 14.
Oktober 1949 laut Handelsregisterauszug ebenfalls der
öffentlichen Verwaltung enthoben
[HR A 7528]. Jedoch noch im April 1951 erstattet
Gschnait den Bericht an die Magistratsabteilung 69. Nun
endete die öffentliche Verwaltung endgültig.
Die Begründung lautete, dass die Gefahr der Vermögensverschleppung
(welches Vermögen?) nicht bestünde und Rückstellungsansprüche
nicht erhoben worden waren.
Stary schreibt am 1. September 1951 an die Magistratsabteilung
62 – Zentralstelle für Vermögenssicherungsangelegenheiten
und stellt den Antrag, Wilhelm Bauer als „öffentliche
Aufsichtsperson“ zu bestellen. Wieder einmal wird in den
Berichten die aussichtslose Lage Starys beschrieben. Es
gibt ein Pfändungsprotokoll vom 27.10.1953 für
den Rest eines Prüferhonorars mit einer Liste
der gepfändeten Bücher. Am 4. Dezember 1953
berichtet Wilhelm Bauer, Stary sei von der Gemeinde delogiert
worden. Seine Bücher usw. wurden in seinem Lager
Wien I., Stoß im Himmel untergebracht. Es handelt
sich um den Lagerraum, den Stary mit der Buchhandlung
"Altes Rathaus" übernommen hat. Keine Stellagen,
ungeordnete Haufen von Büchern! An ein Weihnachtsgeschäft
an dieser abgelegenen Stelle ist nicht zu denken. Noch
einmal wird am 25. April 1955 eine öffentliche Aufsichtsperson
bestellt, es ist Friedrich Katz. In einem Bericht vom
11. November 1955 tauchen Rückstellungsansprüche
von Dr. Gutwillig auf.
Auch der Passus "Deutscher Besitz" muss geklärt
werden:
"Deutscher Besitz
Die unter öffentl. Aufsicht stehende Wallishausser’sche
Buchhandlung, Wien I. war weder vor noch nach dem 13.III.1838
in deutschem Besitz. Sowohl der Vorbesitzer als auch der
Inhaber der Firma nach diesem Zeitpunkte sind österr.
Staatsbürger."
Letzte Adresse:
Stoß im Himmel Nr. 3
Die weitere Entwicklung der Buchhandlung lässt sich
nur noch an wenigen Hinweisen festmachen.
Ab etwa 1955, als Karl Stary 60 Jahre alt wurde, war die
Wallishaussersche Buchhandlung an der für ein Geschäft
entlegenen und für Passanten und Laufkundschaft aufgrund
der versteckten Lage kaum zugänglichen Adresse Wien
I., Stoß im Himmel Nr. 3, zu finden.
Im Jahr 1959 findet sich die letzte Eintragung der Wallishausserschen
Buchhandlung in Lehmanns Adreßbuch.
Der Umstand, dass die Geschäfte schon geraume Zeit
zuvor eingestellt worden waren, bot schließlich
die Grundlage für die Zurücknahme von Karl Starys
Konzession durch die Wiener Landesregierung am 20.4.1960.
Am 22. Juli 1961 schreibt Stary
an Friedrich Katz, wie krank er sei. Noch immer gibt er
nicht auf. Am 13. September 1961 wird Friedrich Katz als
öffentliche Aufsichtsperson abberufen.
Der endgültige Schlussstrich unter die von vielen
Ungereimtheiten bestimmte „Arisierung“ der ehemals jüdischen
Buchhandlung „Wallishausser“ wurde schließlich am
Ende des Jahres 1964 gezogen: Am 29. Jänner starb
der letzte Besitzer der Wallishausserschen Buchhandlung
in Wien. Am 24. November wurden Karl Stary und die Wallishaussersche
Buchhandlung in den Akten des Handelsgerichtes gelöscht
(§§ 31 HGB, bzw. 141 Fgg).

